Gefässchirurgie
Gefässerkankungen im FokusDie Klinik für Gefässchirurgie ist Teil des universitären Gefässzentrums Aarau-Basel mit den Standorten Kantonsspital Aarau und Universitätsspital Basel. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der beiden Abteilungen stellt eine optimale Behandlung von gefässchirurgischen Patientinnen und Patienten sicher und setzt dabei auf die neusten chirurgischen Technologien.
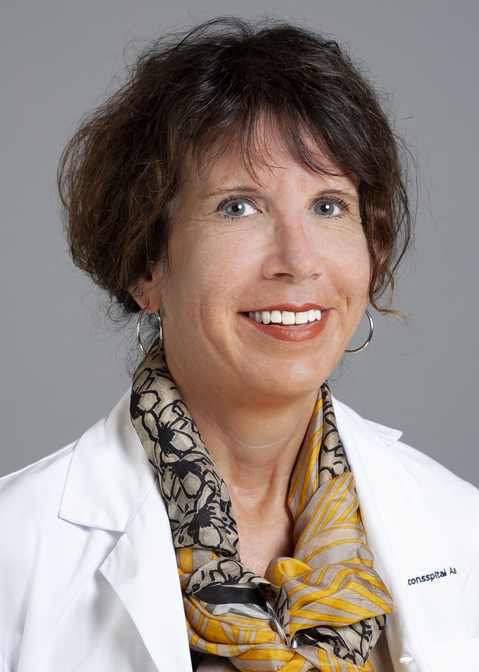
Bei uns sind Sie in guten Händen. Unser interdisziplinäres Team legt Wert auf eine sorgfältige Abklärung und eine Behandlung mit nachhaltigen Ergebnissen.
Patientinnen und Patienten mit einem Gefässleiden haben oft eine längere Leidensgeschichte hinter sich. Neben den Gefässen sind bei ihnen meist auch andere Organsysteme beeinträchtigt. Eine umfassende Abklärung in Zusammenarbeit mit anderen Fachdisziplinen ist deswegen immer Basis bei jeder Behandlung
Behandlungsschwerpunkte in der Gefässchirurgie KSA Aarau sind:
-
Operationen bei Verengungen oder Verschlüssen sowie Erweiterungen (Aneurysmen) von Gefässen
-
Das Einsetzen eines Shunts als Vorbereitung für die Blutwäsche (Dialyse)
-
Die Behandlung von Krampfadern
-
Die Behandlung des Nervenkompressionssyndroms (Thoracic-Outlet-Syndrom)
Wie Sie uns erreichen
-
Sekretariat | Gefässchirurgie
Telefon +41 62 838 96 12E-Mail gefaesschirurgie@ksa.ch
Themenseite «Rund ums Herz»
Auf der Themenseite «Rund ums Herz» bieten wir Einblicke in unser breites Leistungsspektrum, bewegende Patientengeschichten sowie spannende Fakten rund ums Herz und die Gefässe.




