Pneumologie und Schlafmedizin
Bevor Ihnen die Luft ausgeht – wir sind für Sie daIn der Abteilung Pneumologie und Schlafmedizin kümmern wir uns um Patientinnen und Patienten mit Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD sowie vielen anderen Krankheitsbildern.
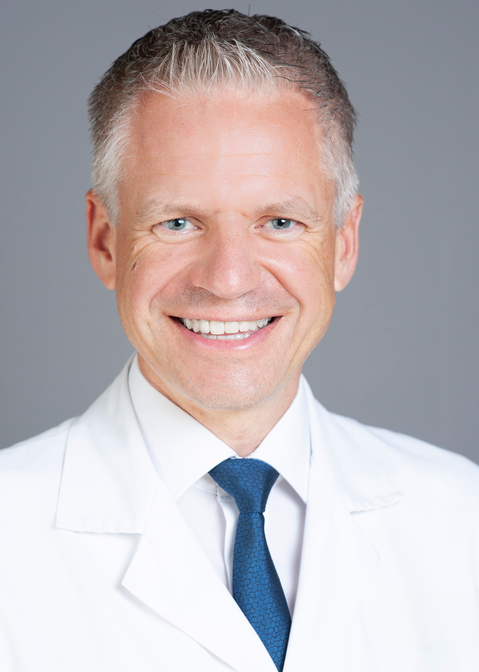
Wir kümmern uns mit Hingabe um das Wohlergehen unserer Patientinnen und Patienten. Modernste Medizin und höchste Patientensicherheit stehen dabei im Zentrum. Zusätzlich bilden wir Fachkräfte für die Pneumologie und Schlafmedizin von morgen aus, um Ihre Versorgung zu sichern.
Willkommen in der Abteilung für Pneumologie und Schlafmedizin KSA Aarau, dem spezialisierten Zentrum für Erkrankungen der Atmungsorgane und für schlafbezogene Störungen. Unser Team widmet sich gemeinsam der Diagnose, Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten. Dabei legen wir grossen Wert darauf, allen Betroffenen mit grösstmöglicher Sorgfalt und Aufmerksamkeit zu begegnen. Wir setzen auf höchste Behandlungsqualität, die durch ein progressives Fehlermanagement ergänzt wird. Als Teil des Medizinischen Universitätsklinik KSA Aarau bieten wir den höchsten medizinischen Standard.
Unsere Expertise umfasst u. a.:
-
Asthma bronchiale
-
Atemmuskelerkrankungen
-
Bronchiektasen
-
Chronischer Husten
-
COPD (chronische Bronchitis, Lungenemphysem, Ventilimplantation)
-
Interstitielle Lungenerkrankungen (idiopathische pulmonale Fibrose (IPF), Sarkoidose u. v. a. m.)
-
Lungenhochdruck (Pulmonale Hypertonie)
-
Schlafmedizin
-
Tumore der Lunge, der Atemwege und des Mediastinums (Mittelbereich des Brustkorbs)
-
Tuberkulose
-
Zystische Fibrose
Unser Zentrum verfügt über fortschrittliche diagnostische und therapeutische Einrichtungen, darunter:
-
Beatmungstherapien
-
Modernste Geräte und Untersuchungsmethoden
Für die Diagnostik und Therapie verfügen wir über Endoskopie, Lungenfunktions- und Schlaflabor sowie Heimventilation.
Wie Sie uns erreichen
-
Ambulatorium | Pneumologie und Schlafmedizin
Telefon +41 62 838 93 93E-Mail pneumologie@ksa.ch
Informationen und Publikationen
Wo Sie uns finden
Häufige Fragen
-
Unsere Klinik verfügt über eine Rauchstoppberatung. Es werden neue Ansätze sowohl nicht medikamentöser wie auch medikamentöser Unterstützung bei Wunsch nach Rauchstopp angewendet.
-
An einem Endversorgungsspital wie das Kantonsspital Aarau ist selbstverständlich rund um die Uhr ein pneumologischer Hintergrundsdienst vorhanden. Bitte verlangen Sie bei der Telefonzentrale die diensthabende Ärztin / den diensthabenden Arzt der Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin. Wir kümmern uns gerne um Ihr Anliegen.
-
Es ist unsere oberste Priorität die Sprechstundentermine rechtzeitig zu beginnen und zu beenden. Zu unseren Verpflichtungen gehört aber sowohl die Betreuung des pneumologischen/schlafmedizinischen Ambulatoriums als auch die Mitbetreuung der stationären Patientinnen und Patienten und der Patientinnen und Patienten auf der Notfallstation. Es kann somit zu Verzögerungen kommen. Diese werden Ihnen fortwährend mitgeteilt. Bitte melden Sie sich rechtzeitig beim Empfang, wenn sie auf Grund dringender Verpflichtungen eine Verschiebung des Besprechungstermins wünschen.
-
Seit Sommer 2015 wurde das Schlaflabor des Kantonsspitals Aarau in Betrieb genommen. In Zusammenarbeit mit dem Ärzteteam der Klinik Barmelweid werden hier schlafmedizinische Untersuchungen namentlich die Polysomnographie, der MSLT und der MWT durchgeführt. Wir sind stolz unser Angebot um diese wichtigen Untersuchungen erweitert zu haben.
-
Für uns ist eine optimale Zusammenarbeit mit den zuweisenden niedergelassenen Ärzten sehr wichtig. Somit ist eine Zuweisung durch den Hausarzt oder dem niedergelassenen Spezialisten ein sinnvoller Zuweisungsweg. Natürlich steht Ihnen aber auch bei entsprechendem Versicherungsstatus eine direkte Selbstzuweisung zu.
-
Sehr gerne beraten wir Sie wenn Sie in die faszinierende Welt des Sporttauchens eintreten wollen. Bei uns können sie die Tauglichkeitsuntersuchung für das Sporttauchen durchführen lassen. Natürlich stehend wir für die im Verlauf notwendigen Kontrolluntersuchungen zur Verfügungen. Dabei richten wir uns nach den Empfehlungen der Schweizerischen Gesellschaft für Unterwasser- und Hyperbarmedizin (SGUHM).
-
Die Klinik für Pneumologie und Schlafmedizin des Kantonsspitals Aarau verfügt als einzige Klinik im Kanton Aargau über dieses Angebot. Wir führen die Behandlung mit Ventilen (valves) und Spiralen (coils) durch.
-
Die Zuweisungen haben in den letzten Jahren stets zugenommen. Eine gewisse Wartefrist ist unumgänglich. Allerdings sind wir sehr bemüht die Zuweisungen nach Dringlichkeit zu beurteilen und die zugewiesenen Klienten entsprechend aufzubieten. Notfallkonsultationen/Notfallzuweisungen sind immer möglich.
-
Die Konsultation wird übernommen. Einige äusserst wirksame Medikamente werden neu ebenfalls kassenpflichtig. Gerne orientieren wir Sie im Detail während der Konsultation.
Aktuelle Studien und Veröffentlichungen
Unser Augenmerk liegt hauptsächlich auf der klinischen Tätigkeit. Wir verfolgen jedoch mehrere Forschungsgebiete:
-
Im Bereich der Atemwegsinflammation (entzündliche Reaktion der Atemwege)
-
Im Bereich der Nachsorgeuntersuchungen nach behandelten Lungentumoren
-
Im Bereich der Pleura-Erkrankungen
-
Im Bereich der Schlafmedizin
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Göhl O, Walker DJ, Walterspacher S, Langer D, Spengler CM, Wanke T, Petrovic M, Zwick RH, Stieglitz S, Glöckl R, Dellweg D, Kabitz HJ. Pneumologie. 2016 Jan;70(1):37-48. German.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Laveneziana P, Albuquerque A, Aliverti A, Babb T, Barreiro E, Dres M, Dubé BP, Fauroux B, Gea J, Guenette JA, Hudson AL, Kabitz HJ, Laghi F, Langer D, Luo YM, Neder JA, O'Donnell D, Polkey MI, Rabinovich RA, Rossi A, Series F, Similowski T, Spengler CM, Vogiatzis I, Verges S. Eur Respir J. 2019 Jun 13;53(6):1801214.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Hoeper MM, Pausch C, Olsson KM, Huscher D, Pittrow D, Grünig E, Staehler G, Vizza CD, Gall H, Distler O, Opitz C, Gibbs JSR, Delcroix M, Ghofrani HA, Park DH, Ewert R, Kaemmerer H, Kabitz HJ, Skowasch D, Behr J, Milger K, Halank M, Wilkens H, Seyfarth HJ, Held M, Dumitrescu D, Tsangaris I, Vonk-Noordegraaf A, Ulrich S, Klose H, Claussen M, Lange TJ, Rosenkranz S. Eur Respir J. 2022 Jul 7;60(1):2102311.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Hoeper MM, Dwivedi K, Pausch C, Lewis RA, Olsson KM, Huscher D, Pittrow D, Grünig E, Staehler G, Vizza CD, Gall H, Distler O, Opitz C, Gibbs JSR, Delcroix M, Park DH, Ghofrani HA, Ewert R, Kaemmerer H, Kabitz HJ, Skowasch D, Behr J, Milger K, Lange TJ, Wilkens H, Seyfarth HJ, Held M, Dumitrescu D, Tsangaris I, Vonk-Noordegraaf A, Ulrich S, Klose H, Claussen M, Eisenmann S, Schmidt KH, Swift AJ, Thompson AAR, Elliot CA, Rosenkranz S, Condliffe R, Kiely DG, Halank M. Lancet Respir Med. 2022 Oct;10(10):937-948.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Hoeper MM, Pausch C, Grünig E, Klose H, Staehler G, Huscher D, Pittrow D, Olsson KM, Vizza CD, Gall H, Benjamin N, Distler O, Opitz C, Gibbs JSR, Delcroix M, Ghofrani HA, Rosenkranz S, Ewert R, Kaemmerer H, Lange TJ, Kabitz HJ, Skowasch D, Skride A, Jureviciene E, Paleviciute E, Miliauskas S, Claussen M, Behr J, Milger K, Halank M, Wilkens H, Wirtz H, Pfeuffer-Jovic E, Harbaum L, Scholtz W, Dumitrescu D, Bruch L, Coghlan G, Neurohr C, Tsangaris I, Gorenflo M, Scelsi L, Vonk-Noordegraaf A, Ulrich S, Held M. J Heart Lung Transplant. 2020 Dec;39(12):1435-1444.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Kösler M, Kabitz HJ, Walterspacher S. 2022 Sep;101(9):745-748. German.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Rosenkranz S, Pausch C, Coghlan JG, Huscher D, Pittrow D, Grünig E, Staehler G, Vizza CD, Gall H, Distler O, Delcroix M, Ghofrani HA, Ewert R, Kabitz HJ, Skowasch D, Behr J, Milger K, Halank M, Wilkens H, Seyfarth HJ, Held M, Scelsi L, Neurohr C, Vonk-Noordegraaf A, Ulrich S, Klose H, Claussen M, Eisenmann S, Schmidt KH, Remppis BA, Skride A, Jureviciene E, Gumbiene L, Miliauskas S, Löffler-Ragg J, Lange TJ, Olsson KM, Hoeper MM, Opitz C. J Heart Lung Transplant. 2023 Jan;42(1):102-114.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Spiesshoefer J, Henke C, Schwarz S, Boentert M, Dellweg D, Kabitz HJ. Pneumologie. 2019 Aug;73(8):486-491. German.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Windisch W, Schönhofer B, Magnet FS, Stoelben E, Kabitz HJ. Pneumologie. 2016 Jul;70(7):454-61.
-
Zum Artikel (auf Pub Med)
Grünig E, Benjamin N, Krüger U, Kaemmerer H, Harutyunova S, Olsson KM, Ulrich S, Gerhardt F, Neurohr C, Sablotzki A, Halank M, Kabitz HJ, Thimm G, Fliegel KG, Klose H. Dtsch Med Wochenschr. 2016 Oct;141(S 01):S26-S32. German.




